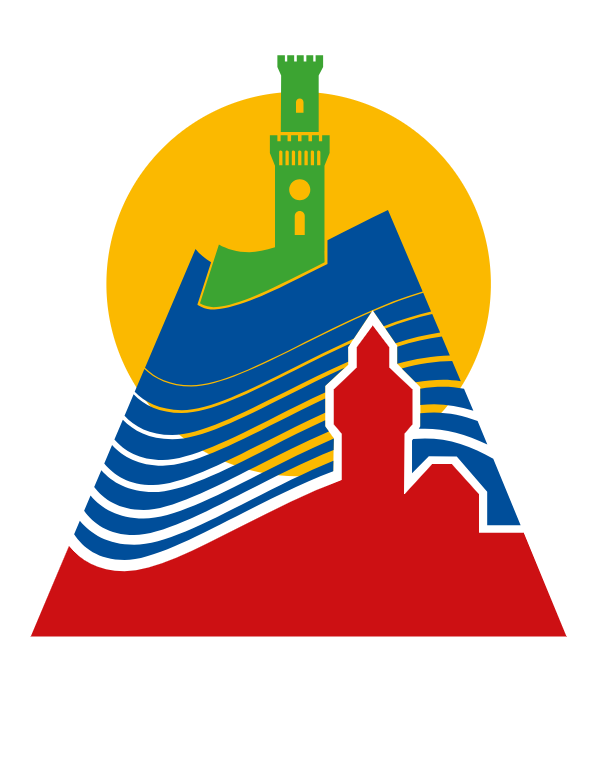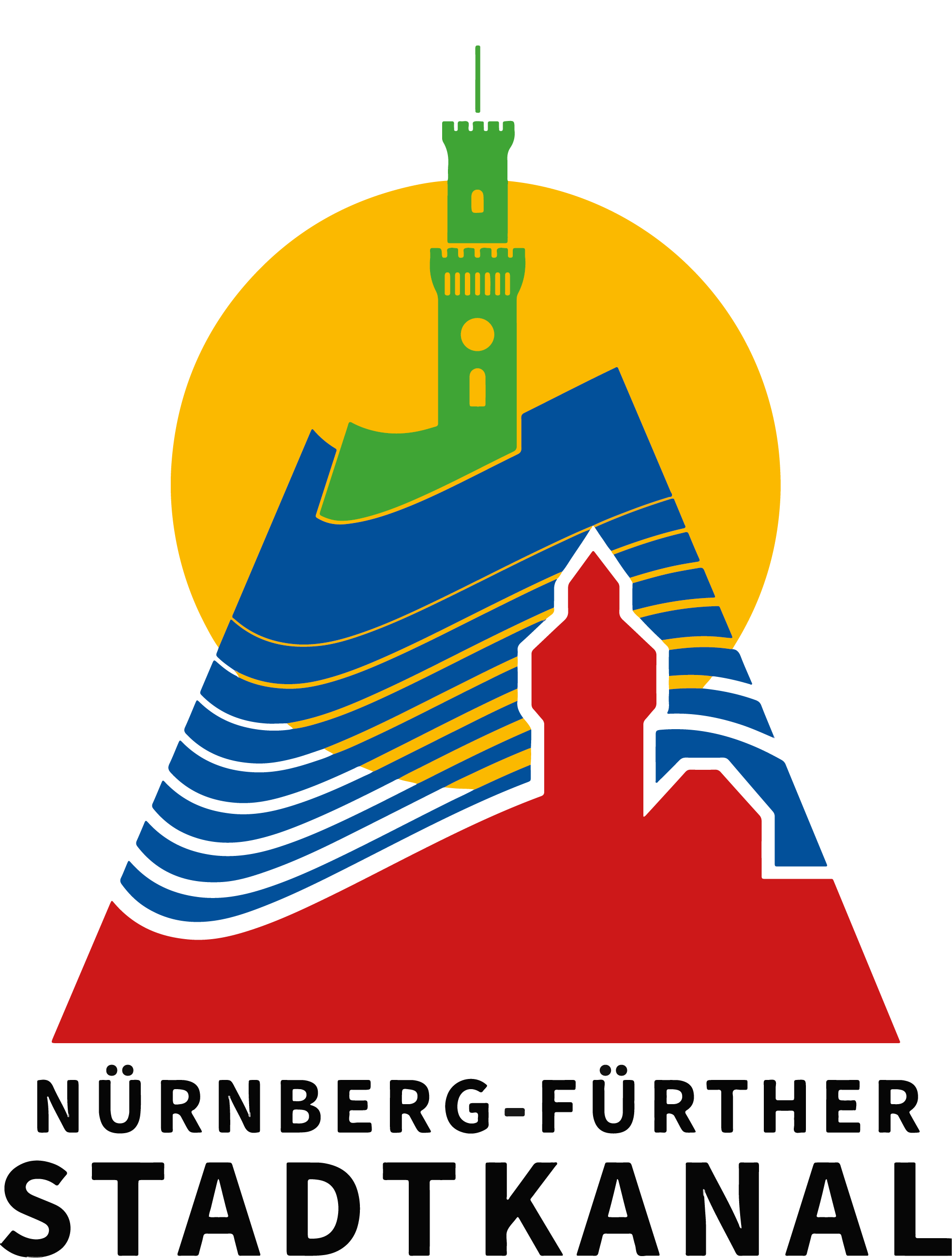NORIS RING BIKING
am 6. Juli 2024
Save the Date!
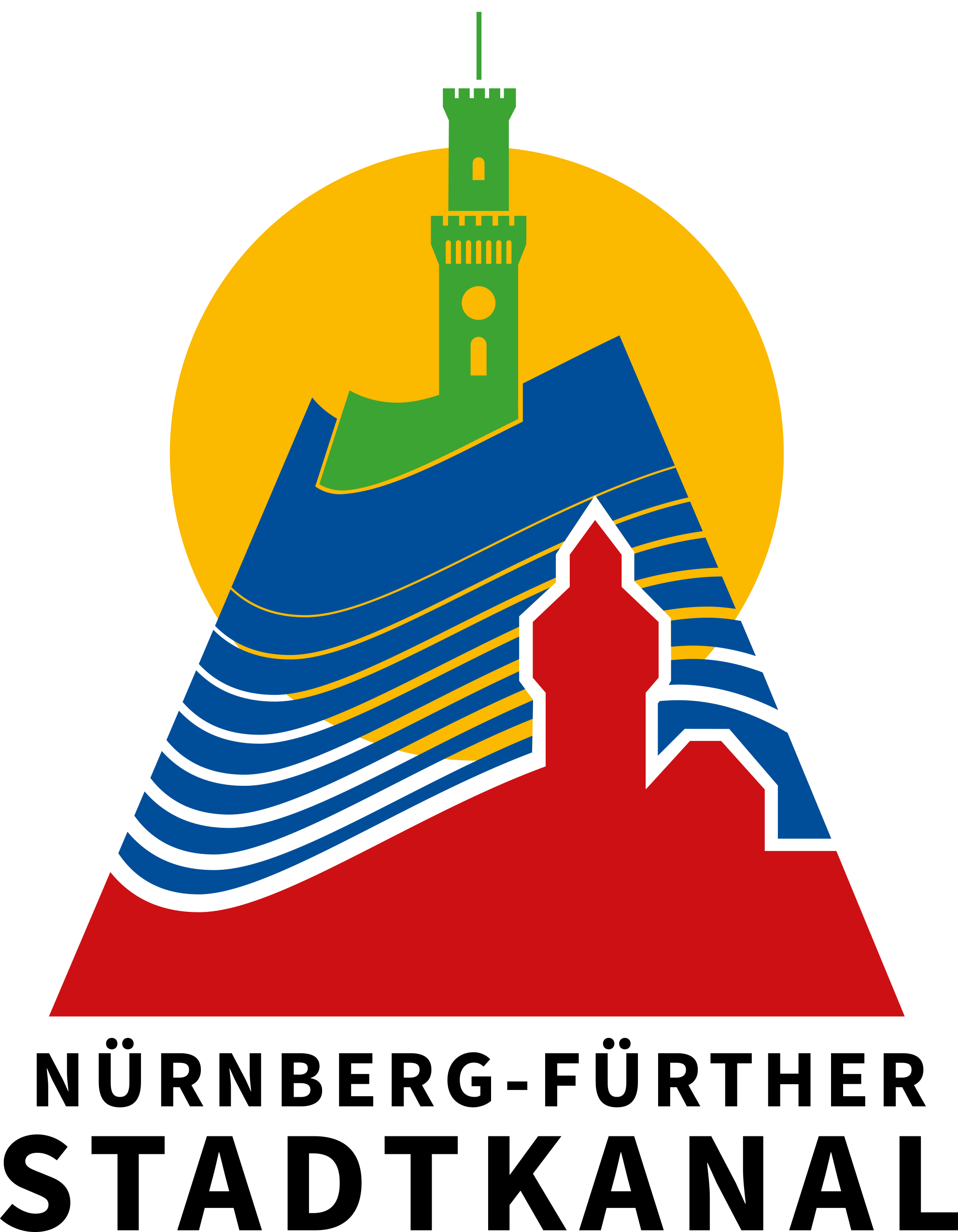
Der Stadtkanal
Heute führt die Autobahn A73 quer durch das Gebiet der Städte Nürnberg und Fürth. Dieser sogenannte „Frankenschnellweg“ wurde in den 1960er Jahren auf der Trasse des alten Ludwig-Donau-Main-Kanals errichtet. Die aktuelle Diskussion dreht sich darum, wie die alltäglichen Staus auf dieser Autobahn, die Nürnberg in eine nördliche und südliche Hälfte zerschneidet, verwaltet werden könnten. Die Pläne für eine Untertunnelung hierfür würden sehr große Mengen Geld verschlingen, aber am Grundproblem eines permanenten Verkehrskollaps’ nichts ändern können.
Der Nürnberg-Fürther Stadtkanalverein vertritt den Standpunkt, dass eine innerstädtische Autobahn nicht mehr zeitgemäß für das 21. Jahrhundert ist. Wir plädieren für eine verkehrspolitische Wende und setzen uns dafür ein, dass die vom unbeschränkten Kraftfahrzeugverkehr in Beschlag genommenen Flächen in eine innerstädtische Wasserlandschaft rückverwandelt werden.
Eine Kanallandschaft bietet gleichermaßen Vorteile für das Stadtklima, nachhaltigen Verkehr und Nutzung der knappen Flächen im dichtbesiedelten städtischen Raum. Darüber hinaus eröffnen sich neue Perspektiven für Tourismus, Freizeit und nicht zuletzt die wirtschaftliche Entwicklung (Gaststätten, Handel, Handwerk und Dienstleistungen).
September 2023:
2. Internationaler Stadtkanalkongress
November 2021:
Verleihung des taz-Panterpreises „Klima für Gerechtigkeit“